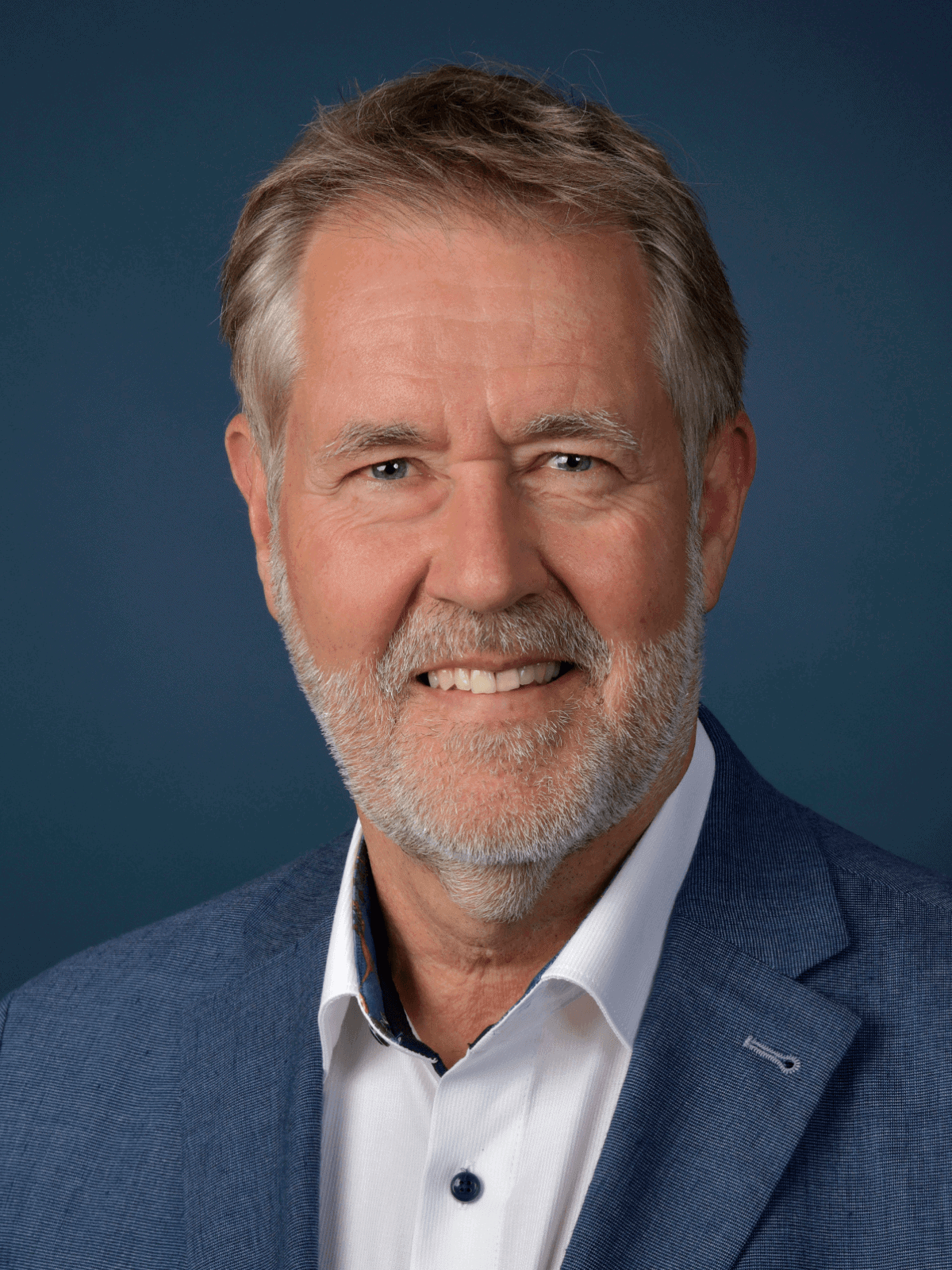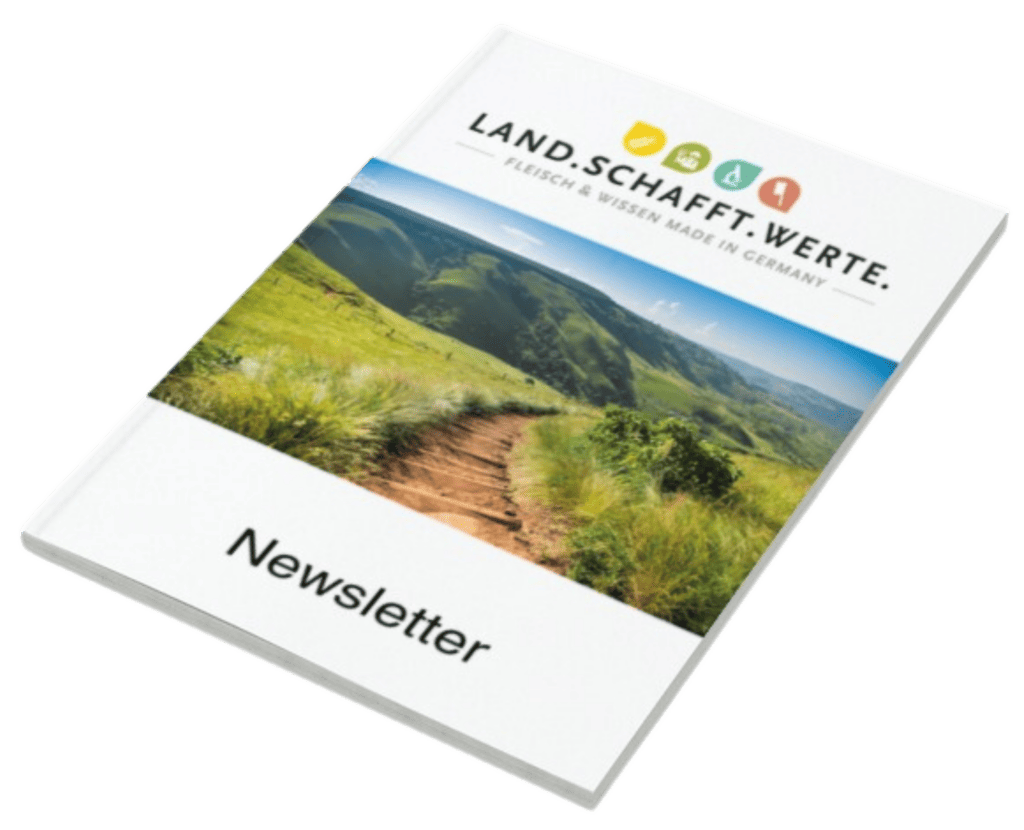Herr Prof. Dr. Windisch, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Beantwortung unserer Fragen in Bezug auf Kühe und der Klimaschutz nehmen. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
Das Interesse an einem Interview mit LAND.SCHAFFT.WERTE ist ganz auf meiner Seite. Ich bin Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt Nutztierwissenschaften und beschäftige mich hauptsächlich mit Fragen der Futterqualität und dessen Umsetzungen im Stoffwechsel der Nutztiere bis hin zum Produkt (Fleisch, Milch, Eier) und allen weiteren Stoffen, die die Tiere wieder in die Umwelt abgeben. Ich habe an der BOKU Wien und später an der Technischen Universität München die Lehrstühle für Tierernährung geleitet und bin vor ein paar Wochen in den Ruhestand übergetreten.
Dieses Interview hat die Absicht, mit dem Narrativ “Kühe sind die Klimasünder unserer Zeit” aufzuräumen. Warum sind Kühe und andere Wiederkäuer in der Diskussion über den Klimawandel und den Klimaschutz so präsent?
Wiederkäuer sind zum Negativbeispiel einer ineffizienten und umwelt- sowie klimaschädlichen Tierhaltung stigmatisiert worden. Ein wesentlicher Grund ist das Methan, das aus dem Verdauungstrakt der Tiere unvermeidlich freigesetzt wird. Und dann fressen Wiederkäuer für ein Kilo Fleisch oder einen Liter Milch ungleich mehr Futter als alle anderen Nutztiere.
All diese Aussagen sind zwar formal korrekt, führen uns aber bei der Bewertung der Wiederkäuer in die Irre. Methan ist sehr wohl ein klimaschädliches Treibhausgas, aber seine Halbwertszeit in der Atmosphäre ist im Gegensatz zu CO2 sehr kurz. Dieses physikalische Prinzip verbieten eigentlich die Umrechnung des Methans mit einem festen Faktor in ein CO2-Äquivalent. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob die Emissionsrate an Methan steigt, konstant bleibt oder gar abfällt. Wenn wir zum Beispiel die Tierzahlen konstant lassen und damit auch die Emissionsrate an Methan, hat es keinen anheizenden Effekt auf das Klima und wäre somit klimaneutral. Wirklich schädlich für das Klima ist nur die Steigerung der Emissionsrate, also eine Zunahme des Tierbestands.
Und beim Futterverbrauch entscheidet nicht die Futtermenge, sondern die Qualität des Futters. Schweine und insbesondere das Geflügel fressen ein Futter, dessen Dichte an verdaulichen Nährstoffen derart hoch ist, dass es auch für Menschen geeignet ist. Von so einem hochkonzentrierten Futter muss ein Nutztier viel weniger verzehren, um die gleiche Menge an Fleisch, Milch oder Eier zu erzeugen, als von einem dünnen Futter. Das gilt genauso auch für den Menschen, wo eine Portion Schokolade etwa der doppelten Menge an Vollkornbrot entspricht. Der Vergleich von Geflügel, Schwein und Wiederkäuer allein auf der Basis der Futtermenge ist also irreführend. In der Effizienz des Stoffwechsels sind Wiederkäuer keineswegs schlechter als Schweine, Geflügel oder Menschen. Zur Erzielung derselben biologischen Leistung fressen sie ganz einfach nur dünneres Futter.
Ihre These ist, dass Kühe gar keine Nahrungskonkurrenten des Menschen sind, sondern eine wichtige Funktion im Gesamtsystem der Landwirtschaft einnehmen. Können Sie uns diesbezüglich einmal die Zusammenhänge erklären?
Wie zuvor erläutert, fressen Kühe und andere Wiederkäuer von Natur aus ein Futter, das so dünn an Nährstoffen ist, dass man davon als Mensch mit vollem Bauch verhungern würde. Sie schaffen das mit Hilfe der Mikroorganismen in ihren Vormägen, die das dünne, faserreiche Futter aufschließen und in hochwertiges Protein sowie verdauliche Nahrungsenergie umwandeln. Dieses Prinzip ist die Krönung der biologischen Evolution der Verdauungssysteme von Tieren. In der Verwertung der Biomasse sind Wiederkäuer somit Schweinen, Geflügel oder gar dem Menschen mit seinem eher archaischen Verdauungssystem weit überlegen. Strenggenommen frisst die Kuh gar kein Gras – sie füttert damit vielmehr die Mikroben ihrer Vormägen und frisst das, was dieses daraus machen. So kann beispielsweise eine Milchkuh aus Gras täglich bis zu etwa 20 Kilogramm Milch erzeugen. Erst bei höheren Leistungen benötigen die Tiere zusätzliches Kraftfutter.
In der Tat kann Kraftfutter essbare Komponenten wie Getreide, Mais oder Soja enthalten. Das muss aber nicht sein, denn die Nebenströme der Verarbeitung pflanzlicher Ernteprodukte in der Lebensmittelindustrie liefern nicht-essbare Biomassen, die als Kraftfutter für Wiederkäuer ebenso gut geeignet sind. Durchaus diskussionswürdig ist allerdings die Verfütterung von Silomais, der auf dem Acker angebaut wird und damit eine indirekte Nahrungskonkurrenz zum Menschen verursachen kann. Das darf aber nicht den Blick auf die Tatsache verstellen, dass die bedeutsamste Futterquelle für unsere Wiederkäuer das sogenannte absolute Grünland darstellt, welches aus topographischen und klimatischen Gründen nicht ackerfähig ist. Zusammen mit den nicht-essbaren Nebenströmen aus der Lebensmittelindustrie liefert es neueren Schätzungen zufolge die Futtergrundlage für etwa zwei Drittel der derzeitigen Produktion an Milch und Rindfleisch. Diese enormen Mengen an höchstwertigen Lebensmitteln stehen somit in keinerlei Konkurrenz zur pflanzenbasierten Nahrung des Menschen, die auf dem Acker erzeugt wird. Wiederkäuer sind also keineswegs grundsätzliche Nahrungskonkurrenten des Menschen.

Wiederkäuer übernehmen noch weitere wichtige Funktionen im Gesamtsystem der Landwirtschaft. Unsere Kulturlandschaft ist in großen Teilen überhaupt erst durch die Schaffung von Grünland entstanden und kann nur mit Hilfe der Wiederkäuer als solche erhalten bleiben. Mit der Offenhaltung der Landschaft durch Wiederkäuer geht ein hohes Maß an Biodiversität auf allen Skalenebenen einher. Weiterhin sind Wiederkäuer ein essenzielles Element der Kreislaufwirtschaft, denn sie überführen die gewaltigen Mengen an nicht-essbarer Biomasse aus der Landwirtschaft in hochwertige Wirtschaftsdünger und führen so die Pflanzennährstoffe zurück in den Boden.
Darüber hinaus bildet das System aus Wiederkäuern und Grünland eine CO2-Senke mit sehr hohem Speicherpotenzial. Gleichzeitig fördert es die Resilienz gegen die Folgen des Klimawandels, denn eine dauerhaft geschlossene Vegetationsdecke mindert bei Dürre die Austrocknung des Bodens und bremst bei hohen Niederschlägen den oberflächlichen Abfluss von Wasser und damit die Erosion.
Wie hoch ist der Anteil der Methanemissionen aus der Tierhaltung im Vergleich zu anderen Quellen von Treibhausgasen?
In Mitteleuropa verursacht die Landwirtschaft knapp zwei Drittel der Gesamtemissionen an Methan. Innerhalb der Landwirtschaft stammt das Methan hauptsächlich aus den Verdauungsprozessen der Wiederkäuer, zu einem kleinen Teil (etwa ein Viertel bis ein Fünftel) aus der Lagerung von Gülle und damit indirekt auch von anderen Nutztieren.
Wie bereits erläutert, ist die absolute Menge an emittiertem Methan jedoch nicht das entscheidende Kriterium für den Effekt auf das Klima, sondern vielmehr die Emissionsrate und ihre zeitliche Veränderung. Wir haben sinkende Bestände an Wiederkäuern und demnach auch sinkende Emissionsraten, die uns aktuell sogar eine Abkühlung für das Klima bringen. Der Rückgang der Bestände hat beispielsweise in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten die Anzahl an Wiederkäuern umgerechnet auf Großvieheinheiten auf das Niveau des Jahres 1800 verringert. Zwar erbringen die Tiere heutzutage höhere Leistungen, fressen mehr Futter und bilden pro Tier auch mehr Methan, aber in Summe emittieren die stark dezimierten Tierbestände weniger Methan als noch zu Beginn der Industrialisierung. Vor diesem Hintergrund hat die Landwirtschaft bereits massive Reduktionen an Methan erzielt.
Bei der Erzeugung von Lebensmitteln tierischer oder pflanzlicher Art entstehen nicht-essbare Nebenprodukte. Diese sollten in den landwirtschaftlichen Kreislauf zurückgeführt werden. Können Sie uns diesen Vorgang erläutern?
Die Bereitstellung pflanzlicher Lebensmittel beginnt immer mit der Ernte ganzer Pflanzenteile, aus denen die Lebensmittel erst mühevoll extrahiert werden müssen. Das beginnt bereits auf dem Acker, etwa durch den Mähdrescher, der Körner und Stroh voneinander trennt. Die Ernteprodukte werden dann in der Lebensmittelindustrie weiterverarbeitet, wobei wiederum große Mengen an Rückständen entstehen, etwa die Kleie in der Mühle oder das Extraktionsschrot bei der Erzeugung von Pflanzenölen. In der Summe landet höchstens ein Fünftel der insgesamt geernteten Pflanzenbiomasse überhaupt in den pflanzlichen Lebensmitteln. Dieses Prinzip gilt auch für die Herstellung neuartiger veganer Produkte. So gelangt nur ein Sechstel der Gesamtbiomasse der Erzeugung von Hafer in den Haferdrink. Beim Seitan, dem Proteinextrakt aus Weizen für die Herstellung von Fleisch- und Wurstimitaten, sind es weniger als 10 % der insgesamt gehandhabten Biomasse des Weizenanbaus.
In den gewaltigen Mengen an nicht-essbarer Biomasse steckt der größte Teil an Pflanzennährstoffen wie Stickstoff, Phosphor usw., die wir durch die Ernte des Pflanzenmaterials dem Boden entziehen. Diese Nährstoffe müssen wieder zurück in den Boden, sonst erleiden wir massive Einbrüche in der Fruchtbarkeit. Zwar könnte man den Entzug von Pflanzennährstoffen auch durch Mineraldünger ausgleichen, aber das würde sehr hohe Einsatzmengen erfordern und wäre insbesondere beim Phosphor problematisch, denn die Lagerstätten an fossilem Phosphor drohen bald zur Neige zu gehen. Zudem würde der Boden an Humus verarmen. Erst die Rückführung von organischem Kohlenstoff aus der nicht-essbaren Biomasse kompensiert diesen Verlust. Aus diesen Gründen ist die Rückführung der nicht-essbaren Biomasse in den Boden für die Erhaltung einer produktiven Landwirtschaft zwingend erforderlich.
Die Rückführung der nicht-essbaren Biomasse kann durch Verrottung auf dem Feld erfolgen oder indirekt über Gärreste von Biogasanlagen bzw. Wirtschaftsdüngern aus der Nutztierfütterung. Die Verrottung hat den Nachteil, dass die Freisetzung von Pflanzennährstoffen mit dem Bedarf der nachfolgenden Pflanzenkulturen nicht synchronisiert ist und die Düngerwirkung dementsprechend gering ausfällt. Gärreste und Wirtschaftsdünger stellen dagegen hochverfügbare Düngerformen dar, die lagerbar sind und zeitlich passend ausgebracht werden können. Im Mittel über die Fruchtfolge erzielen Gärreste und Wirtschaftsdünger deshalb etwa doppelt so hohe Erträge als die Methode der Verrottung. Aber nur bei der Verfütterung an Nutztiere entstehen aus der nicht-essbaren Biomasse zusätzliche Lebensmittel von höchster Qualität und ohne Nahrungskonkurrenz.
Auch die Nutztierhaltung liefert neben dem Wirtschaftsdünger weitere nicht-essbare Nebenprodukte, etwa Knochen etc., aus den Schlachthöfen, die zudem reich an der limitierten Ressource Phosphor sind. Auch hier gilt, dass die Nebenprodukte allesamt in den landwirtschaftlichen Kreislauf zurückgeführt werden müssen. Nicht zuletzt sind auch die erzeugten Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft in den Kreislauf mit einzubeziehen. Bislang ist das kaum der Fall, denn die nach derzeitigem Stand der Technik anfallenden Rückstände der Kläranlagen sind aus Gründen des Umweltschutzes für die Ausbringung auf den Feldern weitgehend ungeeignet. Hier müssen dringend neue technische Konzepte erarbeitet werden, insbesondere in Bezug auf den Phosphor.
Was halten Sie von Cultured Meat und anderen Zellkulturen? Wird das in Zukunft Fleisch, Milch und Eier ersetzen?
Cultured Meat und alle anderen zellulären Verfahren sind nichts anderes als mikroskopisch kleine „Nutztiere“, denn man muss sie mit Biomasse füttern. Der Vergleich solcher Systeme mit herkömmlichen Nutztieren sollte deshalb immer im Zusammenhang mit der Nutzung der landwirtschaftlichen Biomasse in ihrer Gesamtheit erfolgen.
Cultured Meat erfordert ein Kulturmedium in der Qualität einer Infusionslösung, die Menschen zur intravenösen Ernährung bekommen. Deren Herstellung erfolgt mit hohem technischem und energetischem Aufwand aus bereits existierenden pflanzlichen Lebensmitteln und stellt insgesamt die höchstmögliche Form von Nahrungskonkurrenz zum Menschen dar. Darüber hinaus handelt es sich bei Cultured Meat ausschließlich um Muskelzellen und nicht um Fleisch im Sinne eines komplexen Gewebes aus Muskel- und Fettzellen, Bindegewebe usw. Erst die Prozessierung mit Kohlenhydraten und Fett transformiert die Muskelzellen in einen fleischähnlichen Zustand. Zudem stößt der Ausbau der Produktion in eine für das Ernährungssystem relevante Skalenebene an bislang unüberwindbare biotechnologische Hürden. Insofern ist es fraglich, ob Cultured Meat dem echten Fleisch in absehbarer Zeit nennenswert Konkurrenz machen kann.
Precision fermentation und andere Zellkulturen auf der Basis von Hefen sind dagegen durchaus interessant, denn sie können aus anorganischen Stickstoffverbindungen Eiweiß aufbauen. Im Falle der precision fermentation auf der Basis gentechnisch veränderter Hefen sind sogar naturidentische tierische Proteine möglich, beispielsweise Kaseine. Dazu benötigen die Systeme aber immer noch Biomasse als Quelle von Nahrungsenergie. In der Regel ist das Zucker, also grundsätzlich essbare Biomasse, ausgenommen die methylotrophen Hefen wie Pichia pastoris, die Methanol und ähnliche Materialien als Nahrungsenergie verwerten können. Solche Biomassen sind aber schon derart stark degradiert, dass sie für praktisch alle anderen Systeme keine Futterkonkurrenz darstellen. Und auch beim Zucker gibt es Quellen, die für Menschen und herkömmliche Nutztiere nur mit hohem technischem und energetischem Aufwand als Nahrung nutzbar wären, wie etwa die wässrigen, leicht verderblichen Rückstände aus der Seitan-Produktion. Ähnlich zu beurteilen sind auch die Pilze, die ebenfalls aus anorganischen Stickstoffverbindungen Eiweiß aufbauen und als Quelle von Nahrungsenergie stark lignifizierte Biomassen bis hin zu Holz nutzen können, welche als Futter für Wiederkäuer ungeeignet sind.
Hefen und Pilze haben jedoch einen aeroben Stoffwechsel, bei dem die Nahrungsenergie der genutzten Biomasse vollständig veratmet wird. Aus diesem Grunde kann man von solchen Systemen nur das Eiweiß ernten, wobei die Ausbeute bei precision fermentation nochmals deutlich geringer ist, denn das Zielprotein ist nur eine Unterfraktion des gesamten Hefeproteins. Damit unterscheiden sich diese Systeme grundsätzlich vom Wiederkäuer, der in seinen Vormägen anaerobe Mikroorganismen beherbergt. Diese liefern dem Wirtstier aus der Fermentation der Biomasse nicht nur Eiweiß, sondern auch große Mengen an Nahrungsenergie, mit der weitere Produkte aufgebaut werden können. So besteht die Milch nicht nur aus Milcheiweiß, sondern enthält darüber hinaus auch noch Laktose, Milchfett und Mineralstoffe, also die vierfache Menge an Trockenmasse und an Nahrungsenergie für den Menschen. Deshalb sind Wiederkäuer den Hefen und Pilzen in der Verwertung der nicht-essbaren Biomasse überlegen, sofern die Biomasse zur Verfütterung an Wiederkäuer geeignet ist. Hefen und Pilze können dagegen Biomasse nutzen, die dem Wiederkäuer nicht oder nur schwer zugänglich sind. Insofern stellen solche Systeme nicht etwa Alternativen zu Nutztieren dar, sondern sind vielmehr als hochinteressante Erweiterung des Spektrums der Nutzung von nicht-essbarer Biomasse für die Erzeugung von essbarem Eiweiß zu verstehen.
Welche Rolle spielt der Fleisch- und Milchkonsum in der Debatte über den Klimawandel? Wäre ein reduzierter Konsum von tierischen Produkten eine Lösung?
Hier gibt es eine klare Antwort: Die Restriktion des Konsums tierischer Lebensmittel zum Zwecke des Umwelt- und Klimaschutzes verwechselt Ursache und Wirkung.
Weniger Konsum drosselt zwar die Produktion, aber die Umwelt- und Klimawirkungen pro Einheit erzeugter tierischer Lebensmittel bleiben unverändert und können sogar ansteigen. Weit wirkungsvoller ist dagegen die Fokussierung der landwirtschaftlichen Erzeugung von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln auf umwelt- und klimafreundliche Verfahren. In der Nutztierhaltung bedeutet dies in erster Linie die strikte Fokussierung der Fütterung auf die nicht-essbare Biomasse im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft. Dies führt zu einem geringeren Angebot an tierischen Lebensmitteln, insbesondere solche mit hoher Nahrungskonkurrenz, wie etwa Geflügelfleisch und Eier, teilweise auch Schweinefleisch. Die Summe der dann noch angebotenen tierischen Lebensmittel dürfte zwar mengenmäßig ähnlich niedriger liegen als die geforderte Reduktion des Konsums. Die Umkehr der Reihenfolge von Ursache und Wirkung erzielt jedoch einen ungleich stärkeren Effekt auf die Entlastung von Umwelt und Klima. Darüber hinaus können die Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz der Fütterung, zur Verbesserung des Tierwohls und der Tiergesundheit, sowie die Nutzung der lokalen Gegebenheiten für die Pflanzenproduktion im Sinne einer standortgerechten Landwirtschaft weitaus besser genutzt werden. Wieviel tierische Lebensmittel in einer kreislauforientierten Nutztierhaltung dann tatsächlich erzeugt werden, sollte nicht von einer pauschalen Drosselung des Konsums geregelt sein, sondern ausschließlich von der Professionalität einer umwelt- und klimaschonenden sowie standortangepassten Landwirtschaft bestimmt werden.
Können Sie uns einmal erläutern, ob die heutige Fleisch- und Milchproduktion wirklich klimaschädlicher geworden ist als beispielsweise vor 100 Jahren und wenn ja, wie groß ist die Veränderung?
Heutzutage ist die Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft weitaus umwelt- und klimafreundlicher als noch vor hundert Jahren. Hauptursachen sind die Steigerung der tierischen Leistung, die unvergleichlich bessere Erschließung, Gewinnung und Konservierung der Futtermittel, Zusatzstoffe zur Nutzbarmachung unerwünschter Komponente wie Phytat oder des Abbaus antinutritive Inhaltsstoffe wie die Nicht-Stärke-Polysaccharide, Pflanzenzüchtung zur Elimination toxischer Stoffe wie etwa im Raps, Kenntnisse zum Nährstoffbedarf der Tiere inklusive der Schließung von Lücken in der Versorgung mit essenziellen Nährstoffen wie Aminosäuren, Mineralstoffen und Vitaminen, Fortschritte in Tiergesundheit und im Management der Tierhaltung und vieles mehr. Diese Liste wächst kontinuierlich weiter, beispielsweise kommt derzeit die Gewinnung von höchstwertigem Heu mittels Trocknung auf der Basis von Photovoltaik und Solarthermie hinzu. Angesichts der überaus komplexen Fortschritte auf unterschiedlichen Skalenebenen und über Systemgrenzen lässt sich die Gesamtwirkung auf Umwelt und Klima kaum quantifizieren. Bezogen auf eine Einheit erzeugtes Lebensmittel tierischer Herkunft dürfte der Unterschied zu früher weit über Faktor 10 liegen.
Bei all diesen Fortschritten ist allerdings stets zu beachten, dass die positiven Effekte auf Umwelt und Klima der oben genannten Faktoren nicht linear sind. So hat beispielsweise die Supplementierung des Futters mit limitierenden Aminosäuren nur bis zur Deckung des tatsächlichen Bedarfs eine positive Wirkung, nicht aber darüber hinaus. Andere Faktoren können sich bei Überschreitung biologischer Schwellen sogar negativ auf Umwelt und Klima auswirken. So hat die Steigerung der tierischen Leistung eine fortschreitende Verdünnung der unproduktiven Emissionen aus dem Erhaltungsbedarf je Einheit erzeugtes Produkt zur Folge. Das Ausmaß der Verdünnung ist in der Zone der niedrigen Leistung stark ausgeprägt, bringt aber aufgrund des asymptotischen Verlaufs der Verdünnungsfunktion beim Übergang von mittlerer zu hoher Leistung kaum noch spürbare Verbesserungen. In dieser Leistungszone müssen jedoch zunehmend hochwertige Futtermittel eingesetzt werden, die das Risiko von Nahrungskonkurrenz bergen und zusätzliche Emissionen verursachen. Sie verzehren den ohnehin nur noch schwachen Verdünnungseffekt und können die Gesamtwirkung auf Umwelt und Klima sogar wieder schlechter machen. Diese Beispiele zeigen, dass die moderne Nutztierhaltung zwar unvergleichlich umwelt- und klimaschonender sein kann als früher, wir dieses Potenzial jedoch oftmals nicht ausreichend nutzen. Entscheidend ist auch hier wieder die Suche nach der Balance der Nutztierhaltung im gesamten Ernährungssystem im Sinne einer standortangepassten Kreislaufwirtschaft.
Gibt es aktuelle Forschungsprojekte zum Thema Kühe und Klimaschutz, die Sie für vielversprechend halten?
Beim Stichwort Kuh und Klima wird häufig die Drosselung der Methanproduktion als innovatives Forschungsfeld genannt. Das ist meiner Meinung nach allenfalls begrenzt innovativ, denn nur ganz wenige Maßnahmen sind tatsächlich wirksam, ohne gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen zu zeigen. Außerdem kann man den Wiederkäuern die Methanbildung aus biologischen und physiologischen Gründen nicht abtrainieren, auch nicht durch Züchtung. Man muss die Bildung von Methan schlichtweg als eine gewisse Bürde ansehen, die mit dem Futterverzehr untrennbar gekoppelt ist. Außerdem ist das Methan der Wiederkäuer bei konstanten Tierzahlen bzw. konstanter Emissionsrate aus den zuvor genannten Gründen praktisch klimaneutral.
Viel wichtiger ist es, die begrenzte Menge an Biomasse aus der Kreislaufwirtschaft und die damit unvermeidlich gekoppelte Methanbürde möglichst effizient in Milch und andere tierische Produkte zu überführen. Dazu müssen all die oben genannten Potenziale einer umwelt- und klimafreundlichen Nutztierhaltung konsequent umgesetzt werden. Wirklich innovative Forschungsprojekte zielen auf die Quantifizierung und Modellierung der Umwelt- und Klimawirkungen all dieser Faktoren in einem ganzheitlichen Systemansatz unter Einbeziehung aller Produktionslinien inklusive Cultured Meat, Hefen, Pilze sowie und aller Synergien mit weiteren Ökosystemleistungen wie Kulturlandschaft, Biodiversität und Resilienz.
Können wir in Zukunft eine klimaneutrale oder klimapositive Tierhaltung erreichen und wenn ja, was muss dafür geschehen?
Die Tierhaltung kann innerhalb ihrer engen Systemgrenzen nicht klimaneutral werden, genauso wenig wie der Ackerbau. Erst die Verknüpfung dieser Systeme in einer erweiterten Betrachtung des gesamten Ernährungssystems kann Wege aufzeigen, die Gesamtwirkung der Bereitstellung von Nahrung auf Umwelt und Klima zu minimieren und mit anderen Ökosystemleistungen zu kombinieren. Es geht auch gar nicht um die Erzielung von Klimaneutralität in einzelnen Sektoren des Ernährungssystems, denn die oberste Prämisse liegt in der Sicherstellung einer adäquaten Ernährung der aktuell und zukünftig existierenden Anzahl an Menschen mit minimaler Schadenswirkung und maximaler Nachhaltigkeit.
Vielen Dank für das Interview!